Anfang der siebziger Jahre gab das finnischen Industrieunternehmens OY Finnlines Ltd.
einige Marktstudien zu Entwicklung des Deutschland-Finnland Verkehrs in Auftrag. Diese
Studien besagten, daß das Passagieraufkommen von Deutschland nach Finnland in den
achtziger Jahren drastisch steigen sollte. Dem währen die zu der Zeit eingesetzten
Fähren ("Finnhansa" & "Finnpartner" beide ca. 7.500 Br Tonnen)
nicht gerecht geworden. Deshalb plante man den Bau einer neuen "Superfähre".
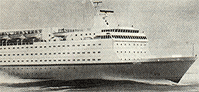
Im Gespräch war das Projekt "Finnhansa II" als konventionelle Fähre mit etwas
größerer Passagierkapazität als ihr Vorgänger; "Finnmidi" wie
"Finnhansa II" nur als Schnellfähre; "Finnslow" als langsamere, aber
erheblich mehr Passagiere fassende Fähre und "FINNJET" als Schnellfähre mit
einer Rundreisedauer von nur zwei Tagen ("Finnhansa & -partner" brauchten 4
Tage), aber geringerer Passagierkapazität als "Finnslow".
"Finnhansa II" und "Finnmidi" schieden aufgrund zu geringer
Bettenkapazität sofort aus. "Finnslow" faste zwar mehr Fahrgäste als
"FINNJET", dies glich "FINNJET" aber mit der halbierten Rundreisedauer
aus, wodurch letztendlich doch mehr Passagier befördert werden konnten. Die extrem hohen
Baukosten von "FINNJET" wurden dadurch ausgeglichen, daß sie zwei Fähren
ersetzte. Damit war die vom heutigen Standpunkt sicher weitsichtige Entscheidung gefallen,
das Projekt FINNJET zu verwirklichen und das gleichnamige Schiff zu bauen.
Der Planung lagen folgende Entwurfskriterien zugrunde:
- Die Rundreise sollte zwei Tage dauern und die Abfahrtszeiten regelmäßig sein.
- Die Liegezeit im Hafen sollte nur zwei Stunden betragen.
- Die Aufenthaltsbereiche sollten erheblich größer als bisher werden.
- Da man keinen Zwischenhafen anlaufen wollte, sollten alle Passagiere in Kabinen
untergebracht werden.
- Die Kabinen sollten aller einer Klasse angehören, und sich nur in der Lage und Größe
unterscheiden. Es sollte drei Typen geben: Die A-Kabine, eine 12 Quadratmeter große
Außenkabine für vier Personen; Die B-Kabine, eine 8 Quadratmeter große Innenkabine für
zwei Personen; Die C-Kabiene, eine 4 Quadratmeter große Innenkabine für vier Personen.
- Die Kabinen des Typs A und B sollten mit WC und Dusche ausgestattet sein.
- Der Kabinenberreich sollte im ruhigeren Vorschiff liegen und klar strukturiert sein.
- Eine sehr zuverlässige Maschinenanlage, da der Fahrplan sehr knapp kalkuliert sein
würde.
Da lange Schiffe generell schneller sind als breite, entschied man sich für einen sehr
langen schmalen Rumpf. Mit 215,6 Metern ist dies immer noch Rekord. Um bei Eisgang den
langsameren Fahrplan (drei Tage für eine Rundreise) einhalten zu könne, wurde die Fähre
nach der höchsten finnischen Eisklasse 1A Super entwickelt.
Die hohe Geschwindigkeit von 31 Knoten (59 km/h) wurde durch eine völlig neue
Antriebsanlage erreicht. Als Antrieb standen zur Wahl eine extrem große Dieselanlage
(90.000 PS) und Gasturbinen (75.000 PS). Der Dieselantrieb wurde nicht gewählt, da er
erheblich mehr Platz benötigt hätte, die Turbine im Schadensfall während der Fahrt
leicht gegen ein mitgeführtes Reserveagregat ausgetauscht werden konnte, und die
Lärmbellastung erheblich höher gewesen währe. Allerdings nahm man damit einige
Nachteile in Kauf, so ist der Kraftstoffverbrauch, der für den Schiffsbetrieb
modifizierten Flugzeug Turbinen, mit 320 Litern hochwertiger Brennstoffe pro Minute (650
Tonnen für eine Rundreise) relativ hoch und die Turbinen erreichen die optimale
Wirtschaftlichkeit nur unter Vollast.
Als Partner für den Bau entschied man sich, nach anfänglichen Diskussionen mit einer 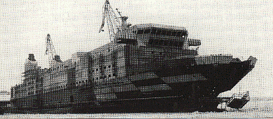 französischen
Werft, für die in Helsinki ansässige Wärtsilä Werft (heute Maasa Yards).
französischen
Werft, für die in Helsinki ansässige Wärtsilä Werft (heute Maasa Yards).
Den Passagieren wurde ein überaus großzügiges Angebot an Gesellschaftsräumen und
Kabinen zugesprochen.
Auch in der Raumaufteilung ging man völlig neue Wege. Alle Kabienen wurden im ruhigen
Vorschiff untergebracht, während die lauten Gesellschaftsräume über dem Maschinenraum
eingebaut wurden. Die A und B Kabienen wurden auf den Decks 4, 5 und 6 untergebracht, die
C-Kabine unter dem Wasserspiegel auf Deck 1. Im hinteren Teil des Schiffes auf Deck 4, 5
und 6 wurden zwei Restaurants, ein Tanzsalon, zwei Bars, eine Disco sowie das
Konferenzzentrum untergebracht. Ganz oben auf Deck 9 wurde die "Sky Bar" mit
bestem Ausblick auf das Meer und unter dem Autodeck ein Schwimmbad mit Sauna und Solarium
errichtet.
Bevor das schnellste, größte und modernste Fährschiff allerdings den Dienst
aufnehmen konnte, mußten einige bauliche Veränderungen geschaffen werden. So wurden in
Helsinki und Travemünde spezielle Hochdruckbunkeranlagen errichtet, um in der kurzen
Liegezeit von eineinhalb Stunden die hohe Treibstoffmenge an Bord nehmen zu können. Auch
mußte die Meeresenge von Kustaanmiekka vor den Toren Helsinkis verbreitert werden.
Um in der kurzen Zeit den Proviant, Zollfreie Waren, und frische Wäsche aufnehmen zu
können, wurde im Heck der Fähre eine Containerbahn eingebaut, die dann die an Land
vorbereiteten Container an Bord nehmen konnte.
Das neue "Superschiff" erreichte, unter anderem aufgrund einer groß
angelegten 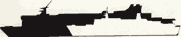 Werbeaktion, schon ein Jahr vor der Jungfernfahrt bis ins Binnenland einen
phänomenalen Bekanntheitsgrad. Finnlines bewarb die FINNJET als "das Schiff der
neunziger Jahre", aus heutiger Sicht ein Slogan mit hohem Wahrheitsgrad. Die FINNJET
ist noch heute das einzige Schiff mit Gastrubinenantrieb und die schnellste konventionelle
Fähre (schneller sind nur die Katermaranfähren).
Werbeaktion, schon ein Jahr vor der Jungfernfahrt bis ins Binnenland einen
phänomenalen Bekanntheitsgrad. Finnlines bewarb die FINNJET als "das Schiff der
neunziger Jahre", aus heutiger Sicht ein Slogan mit hohem Wahrheitsgrad. Die FINNJET
ist noch heute das einzige Schiff mit Gastrubinenantrieb und die schnellste konventionelle
Fähre (schneller sind nur die Katermaranfähren).
Vom Bau der FINNJET profitierte nicht nur die Finnlines, auch die Wärtsilä Werft
erreichte durch sie einen Weltruf. Die FINNJET stellte auch für die finnische
Tourismusbranche eine wichtige Brücke dar, die Finnland beträchtlich näher an
Mitteleuropa rücken ließ. Das gerade das kleine Finnland eine solche technische
Meisterleistung vollbrachte rief allerdings auch Neider auf den Plan. Besonders in
Schweden sprach man immer wieder von einem "Angeberschiff".
Nachdem die FINNJET 1976 schon einmal, im unfertigen Zustand (es fehlte noch der
Außenanstrich und Teile der Inneneinrichtung), unter den Augen von ca. 100.000 Menschen
zur Probe in Travemünde eingelaufen war, wurde sie im Mai 1977 von einigen tausend
Menschen auf ihrer Jungfernfahrt von Helsinki erwartet.
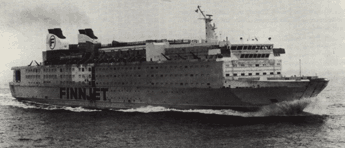 Als erste Überraschung machte sich innerhalb der ersten Wochen der
"Flachwassereffekt" bemerkbar. Die FINNJET konnte ihre Höchstgeschwindigkeit in
der Lübecker Bucht und Teilen der südlichen Ostsee nicht erreichen, da dort die das Meer
weniger als 40 Meter tief ist. Dies hat zur Folge, daß der Rumpf regelrecht vom
Meeresgrund festgehalten wird. Als Konsequenz mußte man die Geschwindigkeit in diesen
Gebieten reduzieren.
Als erste Überraschung machte sich innerhalb der ersten Wochen der
"Flachwassereffekt" bemerkbar. Die FINNJET konnte ihre Höchstgeschwindigkeit in
der Lübecker Bucht und Teilen der südlichen Ostsee nicht erreichen, da dort die das Meer
weniger als 40 Meter tief ist. Dies hat zur Folge, daß der Rumpf regelrecht vom
Meeresgrund festgehalten wird. Als Konsequenz mußte man die Geschwindigkeit in diesen
Gebieten reduzieren.
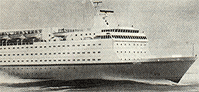
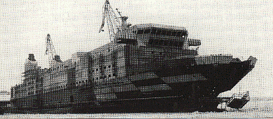 französischen
Werft, für die in Helsinki ansässige Wärtsilä Werft (heute Maasa Yards).
französischen
Werft, für die in Helsinki ansässige Wärtsilä Werft (heute Maasa Yards). 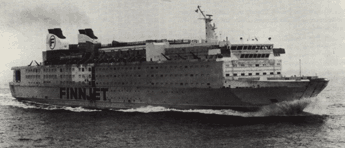 Als erste Überraschung machte sich innerhalb der ersten Wochen der
"Flachwassereffekt" bemerkbar. Die FINNJET konnte ihre Höchstgeschwindigkeit in
der Lübecker Bucht und Teilen der südlichen Ostsee nicht erreichen, da dort die das Meer
weniger als 40 Meter tief ist. Dies hat zur Folge, daß der Rumpf regelrecht vom
Meeresgrund festgehalten wird. Als Konsequenz mußte man die Geschwindigkeit in diesen
Gebieten reduzieren.
Als erste Überraschung machte sich innerhalb der ersten Wochen der
"Flachwassereffekt" bemerkbar. Die FINNJET konnte ihre Höchstgeschwindigkeit in
der Lübecker Bucht und Teilen der südlichen Ostsee nicht erreichen, da dort die das Meer
weniger als 40 Meter tief ist. Dies hat zur Folge, daß der Rumpf regelrecht vom
Meeresgrund festgehalten wird. Als Konsequenz mußte man die Geschwindigkeit in diesen
Gebieten reduzieren.